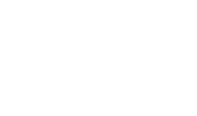Offene Fenster – Einblicke in Methoden und Perspektiven der kunsthistorischen Forschung, Gemeinsames Kolloquium
Sie sind herzlich eingeladen zum ersten gemeinsamen Kolloquium des Kunstgeschichtlichen Instituts
Offene Fenster – Einblicke in Methoden und Perspektiven der kunsthistorischen Forschung
Freitag, 18. Juli 2025; 10 c.t. – 18 c.t.
Veranstaltungssaal der Universitätsbibliothek Freiburg (1. OG, Zugang über das Parlatorium)
Am Freitag, den 18. Juli 2025, laden die Forschungskolloquien des Kunstgeschichtlichen Instituts dazu ein, aktuelle kunsthistorische Projekte kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Unter dem Titel „Offene Fenster“ geben Studierende, Absolvent*innen und Promovierende in neun Vorträgen – gegliedert in drei thematische Panels – Einblicke in ihre Forschungsarbeiten. Im Fokus stehen dabei nicht nur die behandelten Themen, sondern auch die methodischen Zugänge, wissenschaftlichen Fragestellungen sowie Herausforderungen und Erkenntnisse, die den Forschungsprozess geprägt haben.
Die Veranstaltung versteht sich als Plattform für lebendigen Austausch und kollegiale Vernetzung über Qualifikationsstufen, Themenfelder und Kolloquien hinweg.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, teilzunehmen und mitzudiskutieren! Der Eintritt ist frei.
Den Flyer zur Veranstaltung finden Sie hier
Programm:
10:15 Uhr | Beginn und Begrüßung
Kristina Sieling und Amadeus Tkocz
Panel 1: Kunstgeschichte digital
Moderation: Amadeus Tkocz
10:25 Uhr | Architektur ergründen – Grundlagenermittlung für das Bauen im Bestand
Astrid Weil Helmbold
Im Zentrum des Beitrags steht die Umnutzung eines denkmalgeschützten Bauwerks zur kulturellen Veranstaltungsstätte. Ausgangspunkt ist das ehemalige Kulissenhaus des Landestheaters Coburg, ein um 1900 errichtetes Gebäude, das bis in die 1970er Jahre als Requisiten- und Kulissenlager sowie als Atelier für Bühnenbildproduktionen diente. Anhand von Archivarbeit, Gebäudeaufnahme mittels 3D-Laserscan und Gesprächen mit Eigentümer*innen wird die Annäherung an die historische Bausubstanz aufgezeigt. Der Beitrag thematisiert Herangehensweisen, Herausforderungen und Ergebnisse des Projekts.
Astrid Weil Helmbold, B.A., studierte Innenarchitektur in Coburg und studiert seit 2024 Kunstgeschichte sowie Archäologische Wissenschaften im Zweitstudium in Freiburg.
11:00 Uhr | Transdisziplinäre Annäherung an ein multisensorisches Objekt. Der Marienbrunnen im Chorumgang der Freiburger Münsters (1511)
Michelle Kollmann
Gegenstand der Untersuchung ist die digitale Erfassung des spätgotischen Marienbrunnens sowie die mögliche Rekonstruktion der funktionierenden Wasserleitungen im Chorumgang des Freiburger Münsters. Mittels terrestrischem Laserscanning wurden über 352 Millionen Messpunkte zu einer hochpräzisen 3D-Punktwolke verarbeitet. Die methodische Herangehensweise orientiert sich an kunsthistorisch-digitalen Forschungsansätzen wie etwa am Beispiel des Tischbrunnens im Cleveland Museum of Art. Die Arbeit veranschaulicht das Potenzial wie auch die Herausforderungen digitaler Technologien im kunsthistorischen Kontext.
Michelle Kollmann, B.A., studierte Kunstgeschichte und Anglistik in Freiburg. Seit 2024 studiert sie im Masterstudiengang Kunstgeschichte und leitet seit 2023 die Jungen Kulturfreunde des Augustinermuseums Freiburg.
11: 45 Uhr | Seitenweise Kunst: Ein Projektseminar wird öffentlich
Paula Schulze und Laura ten Brink
Im Rahmen eines E-Teaching-Fellowships entwickelten Studierende eine kunsthistorische Website – von der ersten Struktur bis zum fertigen Design. In vier Arbeitsgruppen übernahmen sie Redaktion, Gestaltung, Projektmanagement und technischen Aufbau. Ziel des Projekts war es, nicht nur kunsthistorisches Wissen zu vermitteln, sondern gezielt sogenannte Future Skills wie Medienkompetenz, Teamarbeit, Corporate Design oder den Umgang mit Bildrechten zu fördern. Der Vortrag gibt Einblick in das innovative Lehrkonzept, die Herausforderungen und Erfahrungen im Projektverlauf sowie das Ergebnis: eine öffentliche Website – von Studierenden für alle.
Paula Schulze, M.A., studierte Kunstgeschichte, Spanisch sowie Archäologische Wissenschaft mit dem Schwerpunkt Urgeschichte und Klassische Archäologie in Freiburg und Madrid. Seit 2025 ist sie Wissenschaftliche Assistentin in Freiburg mit einem Schwerpunkt im Bereich der Digital Humanities.
Laura ten Brink, B.A., studierte Kunstgeschichte und Germanistik mit dem Schwerpunkt auf deutscher Literatur in Freiburg. Seit 2022 absolviert sie den Masterstudiengang Kunstgeschichte in Freiburg und verbrachte ein Erasmus-Aufenthalt in Paris.
Panel 2: Annäherungen an mythologische Szenen
Moderation: Kristina Sieling und Amadeus Tkocz
13:30 Uhr | Die Mon(str)umentalität des Drachen. Besonderheiten in der gemeinsamen Cadmus-Darstellung (1588) von Cornelis Cornelisz van Haarlem und Hendrick Goltzius
Julius Gritzner
Heroische Drachenkämpfe sind ein vertrautes Motiv der Kunstgeschichte, doch gerade hier stellt die 1588 entstandene Zusammenarbeit zwischen den flämischen Künstlern Cornelisz van Haarlem und Hendrick Goltzius eine Besonderheit dar. Statt eines triumphierenden Helden dominiert hier der Drache die Bildfläche des Gemäldes und des Kupferstichs, die sich dem selten dargestellten Bildthema aus Ovids Metamorphosen widmen. Der Beitrag untersucht das Zusammenspiel von Textvorlage, antiken Vorbildern und künstlerischer Innovation und Kontext von Bildrezeption.
Julius Gritzner, B.A., studiert Kunstgeschichte an der Universität Freiburg. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Darstellung von Tierwesen in der Malerei der Frühen Neuzeit.
14:10 Uhr | Tarantel, Tanz und Tamburin. Die Personifikation Apuliens in Cesare Ripas Iconologia
Maja Aprile
Im Beitrag werden die Darstellung und Rezeption der süditalienischen Region Apulien in Bildwerken der Frühen Neuzeit untersucht, mit besonderem Schwerpunkt auf Cesare Ripas Iconologia. Im Fokus stehen einerseits die ikonografische Einordnung Ripas Personifikatoin im Vergleich zu anderen Länderpersonifikationen, andererseits die bildliche Darstellung der Tarantella, des apulischen Tanzes. Die Analyse beleuchtet sowohl die Quellen, auf denen Ripas Darstellung basierte, als auch die symbolische Aufladung und Wiedererkennbarkeit des apulischen Tanzes in der frühneuzeitlichen Bildsprache.
Maja Aprile, B.A., studierte Kunstgeschichte und Italienisch in Freiburg. Derzeit absolviert sie ein Masterstudium der Kunstgeschichte und ist sowohl in der Bildstelle des Kunstgeschichtlichen Instituts als auch als kuratorische Assistenz im PEAC Museum Freiburg tätig.
14:45 Uhr | Der Schlaf und seine vielen Gesichter: Hypnos/Somnus in der Kunst der Frühen Neuzeit
Olivia Schmidt-Thomée
Der in der Figur des Hypnos/Somnus personifizierte Schlaf wird in der Kunst der Frühen Neuzeit in bemerkenswerter Vielfalt dargestellt: Mal begegnet uns der antike Schlafgott als sanfter Genius, Gehilfe der Hera/Juno oder Gefährte der Nacht, mal als Gegenüber der personifizierten Wachsamkeit oder Vater der Träume. Im Gegensatz zu anderem mythologischen Bildpersonal lässt sich für Hypnos/Somnus dabei weder eine kontinuierliche Darstellungstradition noch eine regional oder zeitlich konsolidierte Ikonographie feststellen. Der Vortrag gibt einen Überblick über das facettenreiche Erscheinungsbild dieser Figur und fragt nach den ästhetischen, (macht-)politischen und ideengeschichtlichen Dimensionen eines Motivs, das in der Kunstgeschichte bislang wenig systematisch erforscht wurde.
Olivia Schmidt-Thomée, M.A., studierte Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft, Geschichte und Kunstgeschichte in Freiburg. Derzeit promoviert sie in Freiburg zur Personifikation des Schlafs in der Malerei der Frühen Neuzeit.
Panel 3: Kunst mit sakralem Kontext
Moderation: Kristina Sieling
15:30 Uhr | „eine mißlungene Arbeit des siebzehnten Jahrhunderts“ – Einige Bemerkungen zum ehemaligen Lettner des Freiburger Münsters
Gabriel Dissertori
Zur Seite geschafft und ins „ewige Halbdunkel“ verbannt fristen seit 1789 zwei Fragmente des ehemaligen Freiburger Münsterlettners im Norden und Süden des spätromanischen Querhauses ihr Dasein. Die reich geschmückten Fronten markieren einen bewussten Stilbruch mit der gotischen Bautradition, wie sie selbst um 1580 an anderer Stelle des Münsters noch geübt worden war. Der Vortrag beleuchtet die möglichen Wechselwirkungen zwischen der antikisierenden Baugestalt und der Funktion des Lettners im Kirchenraum. Als Memento für Prof. Dr. Erik Forssman profitiert der Kurzvortrag von der Errungenschaft unseres ehemaligen Institutsdirektors, den Diskurs um die antike Formensprache im 16. Jh. über den Weg der gedruckten Architekturtraktate- und Lehrbücher neu erschlossen zu haben.
Gabriel Dissertori studiert Kunstgeschichte und Katholisch-Theologische Studien an der Universität Freiburg. Ein Schwerpunkt seines Interesses gilt baulichen Kleindenkmälern in Südtirol.
16:05 Uhr | Biblical Love Triangle: Abraham, Sarah and Hagar on the engraving of Georg Pencz
Daria Ünver
In sixteenth-century Germany, the Old Testament patriarch Abraham was regarded as a model of fides and familial virtue. Against this backdrop, Georg Pencz’s engraving Abraham and Hagar, showing Abraham Hagar sitting nude on a bed, while his wife Sarah secretly watches, appears disturbing. The work visualizes the moment right before the conception of Abraham’s first son Ishmael and stages a biblical love triangle, rarely depicted in late medieval art. This talk explores the engraving’s iconographic peculiarities and offers an iconological reading based on textual sources, such as Hans Sachs’s writings, and the historical context of the bigamy scandal involving Philip of Hesse: a potential source of inspiration for Pencz’s bold composition.
Daria Ünver, M.A., studierte Kunstgeschichte, Archäologische Wissenschaften und Übersetzungslehre in Freiburg und Simferopol. Derzeit ist sie Stipendiatin der Mertelsmann Foundation und promoviert in Freiburg zur Erotisierung biblischer Figuren aus dem Alten Testament in der Druckgrafik der Deutschen Kleinmeister.
16: 40 Uhr | Wer ist Meister, wer ist Schüler? Die stilistische Vielfalt und die Problematik des Meisterbegriffs am Beispiel des Meisters von Liesborn
Amadeus Tkocz
Das Werk des sogenannten Meisters von Liesborn, eines anonymen westfälischen Künstlers des späten 15. Jahrhunderts, gibt in seiner stilistischen Uneinheitlichkeit Anlass zur Diskussion: Welche Teile lassen sich der Hand des Meisters zuordnen, welche eher Schülern oder Werkstattmitarbeitern? Der Vortrag nimmt die heterogene Werkgruppe zum Anlass, um gängige Zuschreibungspraxen und die Konstruktion künstlerischer Autorschaft kritisch zu hinterfragen. Anhand stilistischer Analysen und im Kontext aktueller Forschung zu spätmittelalterlichen Malerwerkstätten wird der Blick auf das Verhältnis von „Meisterhand“ und kollektiver Produktion geschärft; insbesondere im Hinblick auf die unterschiedliche Wertung, die den Werken infolge von Händescheidungen zugeschrieben wurde.
Amadeus Tkocz, M.A., studierte Kunstgeschichte und Anglistik in Freiburg, Antwerpen und Stuttgart. Derzeit leitet er im Rahmen eines bwDigiFellowships das Projekt SmartStArtHistory am Kunstgeschichtlichen Institut Freiburg.
17:20 Uhr | Abschlussdiskussion mit Kaffee
Moderation: Kristina Sieling und Amadeus Tkocz